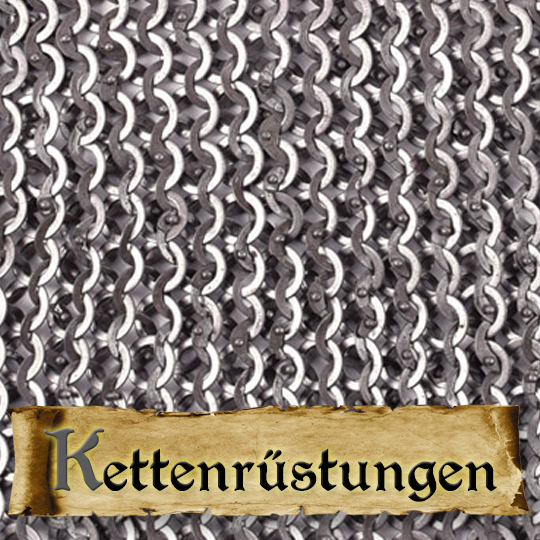Hexenprozess
Hexenprozess
Seit dem 12. Jahrhundert wurden vor geistlichen und weltlichen Gerichten die Delikte Schadenzauber und Hexerei verhandelt. Die Anklage auf Hexerei (etwa Giftmischerei) konnte für den Ankläger selbst gefährlich werden – konnte er seine Beschuldigung nicht schlüssig beweisen, traf ihn wegen Verleumdung die gleiche Strafe, die im Falle der Überführung die Hexe getroffen hätte. Auf diese Weise wurde die Verfolgung wirklich Schuldiger gewährleistet und der Gefahr böswilliger Verleumdungen durch Androhung scharfer Strafen vorgebeugt.
Diese juristisch einigermaßen befriedigende Ordnung änderte sich im 13. Jahrhundert mit der Einführung des Inquisitionsprozesses und der Anerkennung durch Folter erzwungener Geständnisse als Beweismittel. Die päpstliche Bulle "Ad extirpanda" (Innozenz IV., 1252) legitimierte die Folter als Mittel der Beweiserbringung. Nachdem die Kirche Hexerei zur Häresie und zum crimen laesae maiestatis erklärt hatte, war der Feuertod die einzige mögliche Strafe. Hexerei wurde somit als crimen exceptum, als crimen atrox, gar atrocissimum angesehen, denn sie vereinte Ketzerei, Apostasie, Sacrileg, Blasphemie und Sodomie.
Der Inquisitor musste während des gesamten Verfahrens mit dem Teufel kämpfen, den zu überlisten und zu bezwingen außerordentliche Anstrengungen bei der peinlichen Befragung erforderte. Der satanische Komplize der zu Überführenden stand dieser zur Seite, lehrte sie leugnen und lügen, verhärtete sie gegen Schmerz, verwirrte die Zeugen und suchte gar die Richter zu erweichen und zu verblenden.
Einmal unter Anklage, wurde die Delinquentin mit der Folter nicht nur zum Eingeständnis der eigenen Schuld gebracht, es wurden ihr auch Namen von weiteren „Hexen“ abgepresst. Erschienen dem Inquisitionsgericht Anzahl oder Auswahl der Denunzierten als inopportun, so wurde der Widerruf der Anschuldigungen erzwungen. Im zweiten und dritten Viertel des 15. Jahrhunderts schwoll dann die Zahl der Hexenprozesse – besonders in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz – lawinenartig an. Gründe dafür waren die Erzwingung von Denunziation unter der Folter und der grassierende allgemeine Hexenwahn, angefacht durch verstörende Lebensnöte wie Krieg, Hunger und Seuchen. Die Hysterie erreichte um 1700 ihren Höhepunkt und erlosch erst Ende des 18. Jahrhunderts.
Die seelische und körperliche Qual, welche die geistlichen Hexenjäger über ihre Opfer brachten, entzieht sich einer Beschreibung. Folter und endlose Verhöre hatten zudem die Wirkung einer Gehirnwäsche: Die peinlich Befragten gestanden nicht nur alles, was in sie hineingefragt wurde, sie glaubten schließlich selbst, dies alles tatsächlich verbrochen zu haben. Dies umso eher, als von Pfarrern und Wanderpredigern ein Standardbild des Hexenkultes verbreitet wurde, das vielen Menschen als Realität galt. Überführte Hexen wurden dem „weltlichen Arm“ zur Hinrichtung – meist durch das Feuer – übergeben.
Für die Perversion der Hexenprozesse wurden zwar psychologische und sozialpathologische Erklärungen gesucht, eine moralische Bewertung seitens der Kirche steht jedoch noch aus. Joseph Hansen schrieb: "Die Geißel der Hexenverfolgung ist von der Theologie der christlichen Kirche geflochten worden".