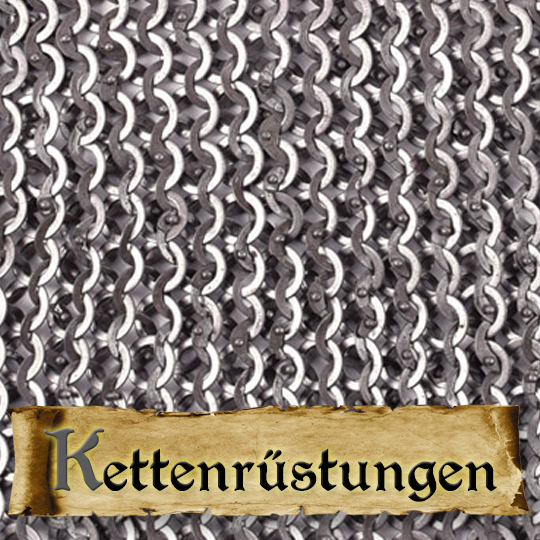Schwitzbäder
Schwitzbäder
Schwitzbäder (zu mhd. switzen; lat. sudare; sudatorium = Schwitzbad) existierten bereits in der Steinzeit. Damals erzeugte man Heißluft durch im Feuer erhitzte Steine, ein Verfahren, das als Steinschwitzbad bekannt ist. Neben Schwitzbädern mit trockener Heißluft gab es auch Heißdampfbäder, die sogenannten Nebelbäder, bei denen heiße Steine mit Wasser übergossen wurden. Diese Bäder förderten durch die Kombination von Wärme (40-50 °C) und hoher Luftfeuchtigkeit (80-100%) die Muskelentspannung, Körperreinigung und Heilung von Atemwegserkrankungen.
Schwitzbäder gelangten aus Russland nach Skandinavien und in die westslawischen Länder sowie aus Kleinasien in den Mittelmeerraum. Mit dem Aufblühen der städtischen Badekultur im 12. Jahrhundert verbreiteten sie sich auch im restlichen Europa.
Die frühesten Zeugnisse von beheizbaren Badestuben stammen aus der Merowingerzeit (5.-8. Jh.). Gemäß der mittelalterlichen Säftelehre sollten schädliche Körpersäfte durch das Schwitzen ausgetrieben werden. Schwitzbäder dienten daher weniger der Körperreinigung und Geselligkeit als der Gesundheit und Heilung. Dazu verwendete man Aufgüsse aus Kräutersuden. Mittelalterliche Abbildungen zeigen Schwitzbäder mit gemauerten Öfen (mhd. padofen), die mit Steinen zur Vergrößerung der heißen Oberfläche bedeckt waren, sowie terrassenartig angeordneten Liege- und Sitzflächen. Die Badegäste wurden nackt massiert, mit Ruten oder belaubten Zweigen (Badequast) gepeitscht und mit Wasser übergossen. Der Dichter Seifried Helbling (13. Jh.) schildert, wie die Badegäste beim Öffnungssignal halbnackt zum Badhaus eilten, sei es aus Bequemlichkeit oder aus Furcht vor Kleiderdiebstahl. Nach dem Bad gönnte man sich eine erholsame Bettruhe.
Hildegard von Bingen schreibt in "Causae et curae" über das Schwitzbad: "Für einen Menschen, der mager und trocken ist, passt das Schwitzbad, nämlich das mit glühenden Steinen bereitete, nicht, weil er sich dadurch noch trockener macht. Wer aber fettes Fleisch hat, dem ist das Schwitzbad gut und nützlich, weil er die Säfte, die in ihm überflüssig sind, durch dasselbe einschränkt und verringert. Auch für den, der gichtkrank ist, sind die mit heißen Steinen bereiteten Bäder vorteilhaft, weil die Säfte, die sich in ihm immer wieder erheben, ... unterdrückt werden." Sie betont, dass Kieselsteine "verschiedene Feuchtigkeiten" enthielten und daher besser Ziegelsteine verwendet werden sollten, da diese beim Brennen ihre Feuchtigkeit verloren hätten.